- Von Sabine Groth
- 17.04.2025 um 11:54
Seit Ende der 1970er Jahre sinkt das Rentenniveau in Deutschland. Vereinfacht gesagt, sind die Renten seitdem langsamer gestiegen als das Durchschnittseinkommen. Auch wenn das Rentenniveau mit den individuellen Rentenansprüchen nichts zu tun hat, so ist es doch ein Indiz, dass die persönlichen Rentenlücken insgesamt größer werden. Ein Ziel der privaten Altersvorsorge ist es, diese aufzufüllen.
Aber selbst wenn in der Vorsorge alles glatt läuft und genügend Kapital aufgebaut wurde, um zum Rentenbeginn die Rentenlücke zu schließen und einen Absturz des Lebensstandards zu verhindern, hat der Berater noch nicht ausgedient. In der Beratung zur Generationenvorsorge sollte sichergestellt werden, dass die Lücke im Alter geschlossen bleibt. Denn auch im Ruhestand, der sich durchaus über zwei Jahrzehnte und länger erstrecken kann, dreht sich die Welt weiter, und die Inflation nagt an der Kaufkraft des angestrebten Einkommens zum Renteneintritt. Dieser Effekt wird oft unterschätzt und wenn nicht gegengesteuert wird, öffnet sich die geschlossene Rentenlücke wieder – und zwar recht dynamisch. Ein Beispiel: Ein monatliches Einkommen von 3.000 Euro zu Beginn des Ruhestands hat nach zehn Jahren nur noch eine Kaufkraft von etwa 2.460 Euro und nach 20 Jahren von knapp 2.020 Euro. Unterstellt ist hierbei eine jährliche Inflation von 2 Prozent. Das ist die Teuerungsrate, die die Europäische Zentralbank anstrebt, um Preisstabilität zu gewährleisten.
Wie hoch die Inflation künftig tatsächlich ausfallen wird und wie sie die einzelnen Kunden betrifft, ist offen. Allerdings sollten Berater im Hinterkopf haben, dass die Inflation aufgrund des speziellen Konsumverhaltens bei Rentnern tendenziell höher ausfallen kann als die amtlich festgestellte Inflation (siehe Teil 5 und Teil 6 der Serie).
Wie die Krankenversicherung für Rentner funktioniert
Konsumausgaben im Alter: Wohin fließt das Geld der Rentner?
Rentner haben ihre eigene Inflation
Steigende Ruhestandseinnahmen verhindern erneute Rentenlücke
Um dem Kaufkraftverlust entgegenzuwirken und keine neue Rentenlücke entstehen zu lassen, muss das monatliche Ruhestandseinkommen stetig steigen. Die gesetzliche Rente, die bei vielen die wichtigste Einkommensquelle im Alter ist, wird regelmäßig angepasst. Allerdings spielt dabei die Inflation keine Rolle, sondern vor allem die allgemeine Lohnentwicklung. Von 2000 bis 2025 sind die Renten in den alten Bundesländern im Durchschnitt pro Jahr um rund 2 Prozent gestiegen – jedoch sehr unterschiedlich von Jahr zu Jahr, es gab auch diverse Nullrunden. Während Rentner und Rentnerinnen in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts Kaufkraft einbüßen mussten, haben die Renten in der zweiten Dekade an Kaufkraft gewonnen. Auch in diesem Jahr dürfte die Erhöhung mit 3,74 Prozent über der Inflation liegen. Ob angesichts der demografischen Entwicklung künftig die Renten in so großen Schritten steigen, ist aber fraglich.
Daher ist es umso wichtiger, dass auch die private Altersvorsorge so angelegt ist, dass sie jährliche Einkommenssteigerungen ermöglicht. Bei Immobilien können beispielsweise regelmäßige Mieterhöhungen, wenn sie denn durchsetzbar sind, dem Kaufkraftverlust entgegenwirken. Bei der privaten Rentenversicherung kann eine lebenslange Verrentung mit Dynamik vereinbart werden. Deren Höhe ist aber nicht frei wählbar, sondern hängt von den Überschüssen ab. 2025 dürften diese aufgrund des – eigentlich begrüßenswerten – Anstiegs des Höchstrechnungszinses von 0,25 auf 1,0 Prozent deutlich niedriger ausfallen als in den Vorjahren. Bei Auszahlplänen aus Fonds oder innerhalb von Fondspolicen sollte ebenfalls eine Dynamik berücksichtigt werden.
Dynamik in Höhe der Inflation reicht nicht
Zudem dürfe bei der Gesamtkalkulation die Steuer nicht vergessen werden, meint Guntram Overbeck. „Damit sich die Rentenlücke im Alter nicht wieder öffnet, reichen Einkommenserhöhungen in Höhe der Inflation nicht aus, um die durch die Inflation bedingten höheren Ausgaben auszugleichen“, so der Leiter Produktmanagement bei Helvetia Leben. Da höhere Einnahmen zu höheren Steuern führen, müsse der Anstieg der Einnahmen über der Inflationsrate liegen (z.B. bei 2% p.a. Inflation ca. 2,5% Einnahmensteigerung p.a.), um eine ausgeglichene Bilanz zwischen Einnahmen und Ausgaben zu gewährleisten. Bei der gesetzlichen Rente ist zudem zu beachten, dass Rentenerhöhungen voll steuerpflichtig sind. Im Rahmen der Einführung der nachgelagerten Besteuerung steigt die Steuerpflicht für gesetzliche Renten derzeit noch schrittweise an. Für alle, die 2025 in Rente gehen, bleibt 16,5 Prozent der Rente bis ans Lebensende steuerfrei. Dieser Satz bezieht aber nur auf den anfänglichen Rentenbetrag, nicht auf spätere Erhöhungen.








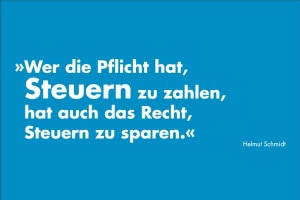






















































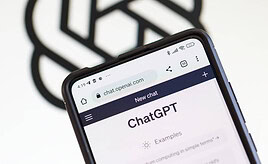





























































0 Kommentare
- anmelden
- registrieren
kommentieren