- Von Andreas Harms
- 25.04.2025 um 14:22
Es ist im Grunde ein schöner Gedanke: Die Solaranlage, genaugenommen die Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage), auf dem Dach erzeugt Strom. Und dieser Strom treibt die Wärmepumpe an, und die heizt das Haus. Kein Strom aus dem öffentlichen Netz mehr nötig – prima. Läuft.
Aber funktioniert das wirklich so einfach? Leider nein. Denn die höchste Stromausbeute und der höchste Strombedarf fallen in genau die entgegengesetzten Jahreszeiten. Also muss man im Winter mit Minimalertrag aus der Solaranlage eine Menge Wärme rausholen. Denn der Sonnenbogen verläuft im Dezember in Deutschland am niedrigsten. Und draußen kann es schon recht frostig zugehen.
Sie ahnen es aber wahrscheinlich schon: Pauschal lässt es sich nicht beantworten, ob der Strom für Warmwasser und Warmheizung reicht. Dazu sind Gebäude, Modelle und Sonnenwinkel zu unterschiedlich. Allein der Unterschied zwischen Hamburg und München im Winter ist enorm.
7 ultimative Gründe für eine Photovoltaik-Anlage
Balkonkraftwerk: Wie gut und schnell sich Batteriespeicher rechnen
Photovoltaik vs. Solarthermie: Achtung, Verwechslungsgefahr!
Aber man kann sich einen Eindruck verschaffen, was möglich und worauf zu achten ist. So listet der Energiedienstleister Senec – eine Tochter der ENBW Energie Baden-Württemberg – für Solarmodule unterschiedlicher Bauart Wirkungsgrade von 10 bis 24 Prozent auf. Damit kann selbst im besten Fall nur ein Viertel der Sonnenenergie wirklich zu Strom werden. Wobei moderne, dickschichtige Solarmodule aus dunkelgrauen monokristallinen Solarzellen am besten abschneiden.
Wobei sich die angegebene Nennleistung einer Solaranlage in Kilowatt-Peak nur auf bestimmte Laborbedingungen bezieht. Bedeckter Himmel, abweichende Neigung und niedrigere Temperaturen können das gleich wieder kippen. Ein hoher Kilowatt-Peak-Wert sagt also längst nicht alles aus.
Aus der Wärmepumpe kommt mehr heraus, als man hineinsteckt
Ebenso unterschiedlich geht es in Bezug auf die Heizung zu. Hier gibt es zunächst die Jahresarbeitszahl (JAZ). Sie misst unter echten Bedingungen, aus wie viel Strom die Wärmepumpe wie viel Heizenergie zaubert. Denn während klassische Heizungen die hineingesteckte Energie (nur zum Teil) in Wärme umwandeln, läuft das bei der Wärmepumpe anders. Sie nutzt elektrische Energie, um aus der Umgebungsluft, Wasser oder Erde Heizenergie zu ziehen. Es kommt also mehr heraus, als man hineinsteckt. Eine JAZ von 4 bedeutet beispielsweise, dass die Heizleistung viermal so hoch ist wie die genutzte elektrische Energie.
Das Magazin „Mein Eigenheim“ listet Wärmepumpen mit JAZ von 2,5 (Luftwärmepumpe) bis 5,0 (Wasserwärmepumpe) auf. Dazwischen liegen noch Erdwärmepumpen mit JAZ von 3,5 bis 4,5.
Und wie viel Strom braucht so eine Pumpe denn nun? Dafür gibt der Spezialist Enpal einige Indikatoren. Für einen sanierten Altbau mit Dämmung ist es ein Wärmebedarf von 0,08 Kilowatt je Quadratmeter. Bei einer Wohnfläche von 100 Quadratmetern macht das 8 Kilowatt. Bei einer JAZ von 4 würde die Wärmepumpe 2 Kilowatt Strom ziehen. Bei einem Neubau nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) wäre es übrigens nur die Hälfte, aber auch die muss die PV-Anlage im Winter erstmal schaffen.
Ob die Heizleistung also ausreicht, hängt vom beheizten Objekt ab. Denn Wärmepumpen heizen das Heizwasser (sogenannte Vorlauftemperatur) nicht so stark auf wie etwa eine Gas- oder Ölheizung. Als ideal gelten deshalb Fußboden- und Wandheizungen, weil sie eine deutlich größere Heizfläche bieten als es klassische Heizkörper jemals können.
Die zweite Frage ist, wie gut das Objekt gedämmt ist. Deshalb eignen sich Wärmepumpen vor allem für Neubauten, die heutzutage fast keine Energie mehr nach außen lassen. Selbst Lüftungsanlagen können inzwischen mit Wärmetauschern arbeiten, sodass zwar verbrauchte Luft hinausgelangt, die Wärme aber trotzdem drinbleibt.
Batteriespeicher ist absolute Pflicht
Wer auch im Winter mit Solarstrom heizen will, muss diese vielen Details beachten. Die PV-Anlage muss genügend Strom für die Wärmepumpe liefern. Und dass ein Batteriespeicher Pflicht ist, versteht sich wohl von selbst. Ansonsten geht nachts die Heizung aus – oder man muss Strom hinzukaufen.
Damit wird klar, dass es die eine Patentlösung nicht gibt. Aber der Photovoltaik- und Wärmepumpenspezialist M. Eberhardt Solar stellt rein aus seiner Erfahrung das – erst einmal – unerfreuliche Ergebnis fest: „Zu 100 Prozent lässt sich der Strombedarf nicht decken.“ Dazu scheint die Sonne zumindest für normale Häuser einfach zu schwach.
Konkret heißt es weiter: „Mit einer ausreichend dimensionierten Solaranlage mit Stromspeicher lässt sich im Winter zirka 15 bis 20 Prozent des Energiebedarfs der Wärmepumpe mit Solarstrom abdecken.“ Wer mehr will, muss die Solaranlage von Anfang an größer bauen oder nachträglich erweitern.
Die Verbraucherzentrale Basen-Württemberg hatte in dieser Hinsicht auch einen Wert ermittelt. Doch der bezieht sich auf das gesamte Jahr und nicht nur auf den prekären Winter, auf den es ja nun hauptsächlich ankommt.
Insofern heißt es: „In Einfamilienhäusern kann eine PV-Anlage ohne Batteriespeicher etwa 20 bis 30 Prozent des Jahresstrombedarfs für Haushalts- und Wärmepumpenstrom erzeugen, mit Speicher etwa 40 Prozent. Unter günstigen Voraussetzungen, also in einem Gebäude mit sehr geringem Stromverbrauch und sehr guter Dämmung können statt 40 Prozent teils auch 60 Prozent des Strombedarfs selbst erzeugt werden.“
Wärmepumpe steigert Eigenverbrauch aus der Solaranlage
Aber in dem Beitrag von M. Eberhardt Solar gibt es auch gute Nachrichten: Auch wenn es nicht komplett reicht, hilft die PV-Anlage auf dem Dach eine ganze Menge. „Es werden zwei erneuerbaren Energiequellen miteinander kombiniert, dadurch wird eine große Menge an fossilen Energieträgern und CO2-Emissionen eingespart“, heißt es in dem Beitrag. Und nebenbei bemerkt: auch Geld.
Außerdem hilft die Wärmepumpe, den Eigenverbrauch an Strom zu steigern. Denn es ist nicht selten der Fall, dass Besitzer von PV-Anlagen Schwierigkeiten haben, den kompletten gelieferten Strom selbst zu verbrauchen. Eben weil er meist dann anfällt, wenn niemand zu Hause ist und der Fernseher nicht läuft. Kombiniert mit einem Stromspeicher könne der Eigenverbrauch sogar auf 70 Prozent steigen, heißt es weiter.
Und noch eine gute Nachricht hat der Energiespezialist, denn er räumt mit einem Vorurteil auf: Eine Wärmepumpe kann sehr wohl auch im Winter bei bis zu minus 20 Grad Celsius ein Wohnhaus gut heizen, ohne dass die Stromkosten durch die Heizdecke gehen. Entsprechende Ergebnisse habe ein umfassender Feldtest von Wärmepumpen eindeutig geliefert.















































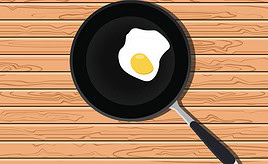

















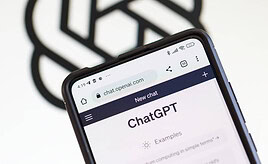






























































0 Kommentare
- anmelden
- registrieren
kommentieren